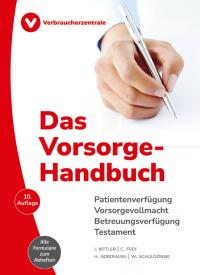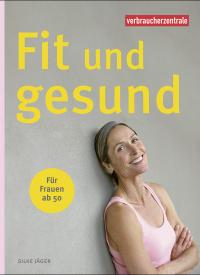Seinem Geld hinterherzulaufen, ist lästig. Bekommen Sie noch Geld von einem Anbieter, können Sie diese Forderung jedoch aktiv und ohne hohe Anwaltskosten eintreiben – mit dem sogenannten Mahnverfahren.
Foto:
sebra / stock.adobe.com
Das Wichtigste in Kürze:
- Bekommen Sie Geld von einem Anbieter nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist, können Sie geringere Summen mit dem sogenannten "gerichtlichen Mahnverfahren" einfordern.
- Ein Mahnverfahren ist im Vergleich zu einer Klage billiger und bringt Ihnen Ihr Geld schneller zurück.
- Fordern Sie Ihren Schuldner zuerst mit einer schriftlichen Mahnung zur Zahlung auf. Zahlt er nicht, können Sie das Mahnverfahren einleiten, um an Ihr Geld zu kommen.
- So verzögern Sie außerdem die Verjährung Ihrer finanziellen Ansprüche.
On
Ob von einem Online-Händler, der Versicherung, dem Energieversorger oder dem Telefonanbieter: Haben Sie eine ausstehende Geldzahlung nicht erhalten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um an Ihr Geld zu kommen. Gerade bei geringeren Summen kann es sinnvoll sein, ein sogenanntes gerichtliches Mahnverfahren einzuleiten.
Wann kann ich Geldforderungen per Mahnverfahren durchsetzen?
Ein Beispiel: Sie haben online bestellte Ware innerhalb der Widerrufsfrist ordnungsgemäß an den Anbieter zurückgesandt. Die Erstattung des Kaufpreises lässt aber auf sich warten. Anwälte winken ab, da ihre Anwaltsgebühren wegen des geringen Streitwertes den Arbeitsaufwand kaum decken. Eine Klage scheint wegen eines geringen Geldbetrages zu aufwändig. Was nun?
In Fällen wie diesen kann Ihnen ein gerichtliches Mahnverfahrens helfen. Die Vorteile: Das Mahnverfahren ist nicht so aufwändig wie eine Klage und spart teure Anwaltskosten. Es läuft weitgehend automatisiert ab. Sie brauchen also keine Gerichtsverhandlung, wenn die Gegenseite der Forderung nicht widerspricht.
Achtung: Lassen Sie Ihre Forderungen nicht verjähren!
Einfache Geldforderungen verjähren in der Regel nach drei Jahren. Warten Sie auf eine Rückzahlung, müssen Sie also spätestens innerhalb dieser Frist handeln, wenn Sie noch an Ihr Geld kommen wollen. Wichtig: Eine einfache Zahlungsaufforderung reicht rechtlich meist nicht aus, um die Verjährung Ihrer Forderung zu stoppen. Dazu ist die Einleitung eines sogenannten Verfahrens zur Rechtsverfolgung erforderlich, zum Beispiel einer Klage oder eben eines gerichtlichen Mahnverfahrens.
Das Mahnverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren, in dem sie (noch) nicht umfangreich nachweisen müssen, ob Sie tatsächlich ein Recht auf eine Zahlung haben. Sie müssen zunächst nur einmal behaupten, dass Ihnen ein Zahlungsanspruch zusteht. Eine inhaltliche Prüfung findet nicht statt. Die kommt erst dann, wenn es zu einem "gewöhnlichen Verfahren" vor dem zuständigen Gericht kommt, etwa, wenn der Angemahnte Widerspruch eingelegt hat. Wenn Sie eine Forderung per Mahnbescheid geltend machen, sollte sie also von vornherein Hand und Fuß haben.
Gerichtliches Mahnverfahren einleiten: So geht’s
Das ist der Weg, um ein gerichtliches Mahnverfahren einzuleiten:
- Schritt 1: Mahnung schreiben
Haben Sie ausstehende Zahlungen nicht erhalten, sollten Sie Ihren Schuldner im ersten Schritt mit einer schriftlichen Mahnung zur Zahlung auffordern. Das ist die Voraussetzung, um später gegebenenfalls ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten zu können. Entgegen vieler Stimmen besteht übrigens keine Pflicht, Ihren Schuldner dreimal zu mahnen. Eine nachweisbar zugestellte Mahnung reicht aus.
Achten Sie bereits bei der Mahnung darauf, Ihre Forderung klar erkennbar zu machen:
- Nennen Sie im Mahnschreiben den Grund für die Forderung sowie die exakte Höhe.
- Setzen Sie eine Zahlungsfrist. Üblich sind in der Regel zwei Wochen.
- Vergessen Sie nicht, Ihre Bankverbindung anzugeben.
- Geben Sie ein Rechnungsdatum sowie eine Rechnungsnummer von der Rechnung an, auf die sich Ihre Forderung bezieht.
Zustellung der Mahnung: Um im Zweifel nachweisen zu können, dass Sie eine Mahnung verschickt haben, empfehlen wir eine Versendung per Einschreiben mit Rückschein oder Einwurf-Einschreiben.
- Schritt 2: Mahnbescheid beantragen
Ist die Rechnung nach Ablauf der von Ihnen in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist nicht bezahlt, können Sie nun ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten. Beachten Sie dabei: Das gesamte Mahnverfahren ist streng formalisiert. Das heißt, für viele der einzelnen Verfahrensschritte gibt es Vordrucke, die Sie zwingend benutzen müssen.
Um das Verfahren zu beginnen, müssen Sie zunächst einen Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids stellen. Daraufhin stellt das Gericht Ihrem Schuldner einen Mahnbescheid per Post zu.
Sie können den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids entweder über einen offiziellen Vordruck oder auch direkt online stellen. Das Formular für den Antrag bekommen Sie in allen größeren Schreibwarenläden.
Wollen Sie den Mahnantrag direkt online als Barcodeantrag oder – sofern eine Signaturkarte vorliegt – als online übermittelte Datei stellen, können Sie dies über das Mahnportal der Bundesländer tun.
Hier finden Sie auch eine Anleitung, die Ihnen beim Ausfüllen des Mahnbescheids hilft. Für weitergehende Hilfe beim Ausfüllen wenden Sie sich an das zuständige Amtsgericht Ihres Wohnortes.
Alle weiteren Formulare, die Sie danach für das Mahnverfahren benötigen, stellt Ihnen das Gericht zur Verfügung.
Beachten Sie: Um eine Verjährung Ihrer Ansprüche zu verhindern, müssen Sie beim Ausfüllen auf die exakte Bezeichnung des Anspruchs achten. Die Art des Anspruchs können Sie entweder anhand einer vorgegebenen Liste auswählen oder in freier Formulierung eintragen.
- Schritt 3: Zustellung des Mahnbescheides
Haben Sie den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids gestellt, kümmert sich das Amtsgericht um die Zustellung.
Der Empfänger des Mahnbescheids hat dann drei Möglichkeiten zu reagieren:
- Er zahlt Ihnen das Geld – dann ist die Sache erledigt.
- Er tut gar nichts – dann sollten Sie einen Vollstreckungsbescheid (siehe Schritt 4) beantragen. Mit einem Vollstreckungsbescheid können Sie Ihren Anspruch zwangsweise durch den Gerichtsvollzieher durchsetzen lassen.
- Er legt Widerspruch ein – dann kommt es zu einem "gewöhnlichen Prozess" vor dem zuständigen Gericht, wenn sie dies beantragt haben. Das zuständige Gericht ist in der Regel das Gericht am Wohnsitz oder Firmensitz des Zahlungspflichtigen.
Das Gericht fordert Sie auf, Ihren Anspruch schriftlich zu begründen. Dies können Sie häufig selbst tun: Bei kleineren Klagesummen, für die die Amtsgerichte zuständig sind, besteht kein Anwaltszwang. Bei einfachen Sachverhalten, die Sie auch leicht beweisen können, können Sie theoretisch auf die Einschaltung eines Anwalts verzichten. Im Gerichtsverfahren sind allerdings vielerlei Fristen und Formalitäten zu beachten. Sie sollten also über eine gewisse Erfahrung verfügen, wenn Sie nicht das Risiko eingehen wollen, den Prozess allein durch formelle Fehler zu verlieren. - Haben Sie keine Durchführung eines streitigen Verfahrens beantragt, passiert bei Widerspruch der Gegenseite – gar nichts. Außer, dass Sie auf den Kosten für das Mahnverfahren sitzen bleiben.
- Schritt 4: Vollstreckungsbescheid beantragen
Unternimmt Ihr Antragsgegner nach Zustellung des Mahnbescheids nichts, sollten Sie im nächsten Schritt einen Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides stellen. Hintergrund: Erst der Vollstreckungsbescheid ist ein sogenannter "Vollstreckungstitel", mit dem Sie Ihren Anspruch durch den Gerichtsvollzieher eintreiben lassen können.
Den Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids können Sie
- frühestens nach Ablauf der zweiwöchigen Widerspruchsfrist und
- spätestens bis sechs Monate nach Zustellung des Mahnbescheides stellen.
Den Vordruck für den Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheids bekommen Sie automatisch mit der Zustellungsnachricht des Mahnbescheids vom Gericht. Dieser ist dann bereits mit Geschäftsnummer, Betreff und Rücksendeanschrift versehen. Auf der Rückseite der Zustellungsnachricht finden Sie zudem ein Durchschriftexemplar für die eigenen Akten.
Beachten Sie: Nur mit diesem offiziellen Vordruck erhalten Sie einen Vollstreckungstitel.
Den ausgefüllten Vollstreckungsbescheid können Sie Ihrem Schuldner
- entweder selbst zustellen lassen (z. B. durch einen Gerichtsvollzieher) oder
- über das Gericht zustellen lassen.
Kümmern Sie sich selbst um die Zustellung, bekommen Sie zwei Ausfertigungen des Vollstreckungsbescheids zugesandt. Bei der gerichtlichen Zustellung hingegen bekommt Ihr Schuldner eine vollstreckbare Ausfertigung des Vollstreckungsbescheids vom Gericht zugesandt. Hierauf steht auch das Zustelldatum.
Einspruch gegen Vollstreckungsbescheid
Gegen den Vollstreckungsbescheid kann Ihr Schuldner innerhalb einer Frist von in der Regel zwei Wochen nach Zustellung Einspruch einlegen. Ist dies der Fall, kommt es automatisch zu einem "normalen" Zivilprozess vor Gericht.
- Schritt 5: Antrag auf Zwangsvollstreckung
Legt der Empfänger des Vollstreckungsbescheids keinen Widerspruch ein, hat der Vollstreckungsbescheid die Wirkung eines Urteils in einem Klageverfahren. Als Antragsteller können Sie hiermit die Zwangsvollstreckung betreiben also Ihren Anspruch durch einen Gerichtsvollzieher durchsetzen lassen.
Sämtliche Verfahren der Zwangsvollstreckung finden vor dem Vollstreckungsgericht statt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, zum Beispiel bei Vollstreckung in Immobilien, ist immer das Amtsgericht am (Wohn-) Sitz des Schuldners zuständig. Dieses benötigt immer die vollstreckbare Ausfertigung des Vollstreckungsbescheids. Eine Kopie ist nicht ausreichend.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung. In der Regel wird jedoch zunächst ein Gerichtsvollzieher beauftragt. Falls Sie Fragen zur Zwangsvollstreckung haben, wenden Sie sich am besten direkt an das zuständige Vollstreckungsgericht oder an das Amtsgericht, welches für Ihren Wohnsitz zuständig ist.
Welches Gericht ist für mein Mahnverfahren zuständig?
In Deutschland gibt es nur noch das so genannte automatisierte, zentrale Mahnverfahren. Das früher genutzte "manuelle und dezentrale Verfahren" beim örtlichen Amtsgericht gibt es nicht mehr. Zuständig für Ihr Mahnverfahren ist demnach immer das zentrale Mahngericht des Bundeslandes, in dem Sie wohnen. Welches das ist, zeigt die Übersicht auf dem Mahnportal der Länder.
Keine Sorge: Reichen Sie den Antrag bei einem anderen als dem eigentlich zuständigen Gericht ein, so kann ihn diese Stelle an das zuständige Amtsgericht weiterleiten. Beachten Sie jedoch: Rechtliche, insbesondere fristwahrende Wirkung hat der Antrag erst, wenn er auch beim tatsächlich zuständigen Mahngericht eingeht.
Gerichtsgebühr und Zustellkosten: Welche Kosten entstehen für mich?
Durch den Eingang Ihrer Anträge entstehen beim Gericht Kosten. Als Antragsteller müssen Sie für diese Gerichtsgebühren sowie für die Zustellkosten der Bescheide aufkommen. Die Gebühren hängen von der Höhe der offenen Geldforderung ab. Auf der Website zu Mahngerichten finden Sie einen Online-Rechner, der Ihnen einen Anhaltspunkt gibt, mit welchen Kosten Sie in etwa rechnen müssen.
Welche Einschränkungen gelten für gerichtliche Mahnverfahren?
Gerichtliche Mahnverfahren eignen sich vor allem bei geringen Streitwerten und eindeutigen Sachverhalten. Es gibt jedoch zwei Einschränkungen, um Ihr Geld per Mahnverfahren einzutreiben:
- Sollte der Schuldner dem Mahnbescheid widersprechen, bleibt Ihnen nur noch das reguläre Klageverfahren, um Ihre Forderung geltend zu machen.
- Ihr Schuldner muss seinen Sitz in Deutschland haben. Lebt Ihr Schuldner hingegen im (EU-)Ausland, sollten Sie sich vorher anwaltlich beraten lassen.
Hinweis: Die bisherigen Ausführungen gelten für das deutsche Mahnverfahren. Also für den Fall, dass Ihr Schuldner seinen Sitz in Deutschland hat.
Europäisches Mahnverfahren
Auch bei grenzüberschreitenden Fällen ist eine schnelle und kostengünstige Beitreibung Ihres Geldes möglich – jedenfalls innerhalb des EU-Raums. Das europäische Mahnverfahren kann ins Spiel kommen, wenn Gläubiger und Schuldner in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ansässig sind. Soweit es nicht um arbeitsrechtliche Ansprüche geht, ist in Deutschland für die Bearbeitung von Anträgen im europäischen Mahnverfahren ausschließlich das Amtsgericht Berlin-Wedding zuständig.
Vorgehen beim europäischen Mahnverfahren
- Der Antragsteller füllt das Antragsformular "Formblatt A" aus.
- Ist der Antrag nicht offensichtlich unbegründet, erlässt das Gericht den Europäischen Zahlungsbefehl und stellt ihn dem Antragsgegner zu.
- Nach Ablauf der Einspruchsfrist (30 Tage beginnend ab Zustellung) erklärt das Gericht den Zahlungsbefehl für vollstreckbar.
- Der Antragsteller kann den Zahlungstitel dann zwangsweise durchsetzen, allerdings muss dies dann im jeweiligen EU-Mitgliedstaat erfolgen. Und: Im Falle eines Einspruchs beginnt – wie beim deutschen Pendant – ein ordentlicher Zivilprozess. Bei Fallgestaltungen mit Auslandsbezug empfiehlt sich daher eine vorherige anwaltliche Beratung.
Die "andere Seite": Wenn Sie einen Mahnbescheid erhalten